Ob wir am lieber am Dienstag um 14 Uhr zum Eltern*nachmittag mit Kinderbetreuung kommen wollen, oder am Mittwoch um 16 Uhr, dann aber ohne Kinderbetreuung, fragt ein Zettel im Kita-Fach meines Kindes. Lange müssen wir nicht überlegen. Ich habe an dem Dienstag und an dem Mittwoch Termine und keine Zeit. Wenn ein Elter nicht verfügbar ist, kommt nur der Termin mit Kinderbetreuung infrage. Wir setzen unser Kreuzchen also bei Dienstag und hoffen, dass die Mehrheit der Krippeneltern ebenfalls den Termin mit Betreuung vorzieht.
Wohin mit dem Kind?
Tut sie aber scheinbar nicht. „Herzliche Einladung zum Elternnachmittag am Mittwoch!“ steht auf den Zettel, der eine Woche später im Fach liegt. Ich packe ihn kommentarlos ein. „Ja das wäre schon wichtig, dass Sie kommen“, sagt eine Erzieherin zu mir. „Das ist ja auch Ihr erster Elterntermin, oder?“ Das stimmt. Es ist der erste Elternnachmittag in der Kita und wir freuen uns schon lange darauf, darüber zu diskutieren, ob jedes Kind seine eigene Sonnencreme mitbringt oder ob gemeinschaftlich die teuerste angeschafft wird. Aber ich kann nicht und TT hat das Kind, das explizit nicht geladen ist.
Wir fragen uns, wie die anderen das machen. Denen geht es doch sicher ähnlich. Oder? Wäre ich verfügbar, würde ich sofort anbieten, die Kinder zu betreuen. Entweder in den Gruppenräumen oder auf dem Spielplatz gegenüber. Kein Problem. Maximal wären es 10 Kinder, realistisch betrachtet höchstens die Hälfte. Aber ich bin dieses Mal halt nicht da.
Geil. Voll nett!
In der Whats-App-Elterngruppe bleibt es auch wenige Tage vor dem Termin ruhig. Haben sich alle privat organisiert? Ist ihnen das Treffen egal? Wir smsen den Eltern* von E., die sehr sympathisch sind und die bisher mit großer Freude unseren Einladungen zum Kennenlernen und Netzwerken unter den Kita-Eltern* gefolgt sind. „E.s Großeltern kommen“, lautet die Antwort. Und sie bieten an: „Wir fragen sie mal, ob sie auf J. auch aufpassen würden.“ Geil. Voll nett! Und wir haben Glück, tatsächlich haben die Großeltern kein Problem damit, für eine gute Stunde auf ein weiteres Kind aufzupassen und wir haben die erste echte Fremdbetreuung überhaupt organisiert. Tschatsching!
Als ich am Montag vor dem Mittwoch mit dem Elternnachmittag mit dem Kind und einigen anderen Krippen-Eltern auf dem Spielplatz in der Sonne stehe, kommt das Gespräch auf den Termin. „Ah, das ist ja übermorgen. Kommt ihr?“ „Ne, wir können nicht.“ „Und ihr?“ „Ne, wir können auch nicht, ist ja ohne Betreuung.“ „Und wie ist es mit euch?“ Ich traue mich fast nicht zu antworten. Es ist mir peinlich, dass wir etwas organisiert haben, ohne in die Runde zu fragen, obwohl wir uns ziemlich sicher waren, dass fast alle das gleiche Problem haben würden. Ich berichte also kleinlaut, dass E.s Großeltern auf J. und E. aufpassen werden und ernte anerkennende(?) Blicke. Fast fühle ich mich genötigt, ein relativierendes „Werweißobesüberhauptklappt“ hinterher zu schieben. Aber ich halte es aus und sage nichts. Die Betreuung ist uns schließlich auch nicht zugeflogen. Viel haben wir zwar nicht dafür getan, aber zumindest eines: Wir haben nach Hilfe gefragt.
Kein Interesse an Eltern-Netzwerken
Das war eigentlich gar nicht so schwer. Wir haben eine Nachricht geschrieben, uns kurz besprochen, die Risiken abgewägt und auch wegen dem guten Bauchgefühl zugesagt. Das war schon alles. Dennoch ist vor allem der erste Schritt für viele Menschen eine riesige Herausforderung. Sich selbst und nach außen einzugestehen, dass die Kernfamilie nicht ausreicht und dass Eltern manchmal Hilfe brauchen.
Für mich persönlich war das immer klar und ich habe von Anfang an versucht, über Krabbelgruppen und ähnliches Kontakte mit Menschen aus der unmittelbaren Umgebung zu knüpfen, um ein Eltern-Netzwerk aufzubauen. Aber schon damals und auch jetzt im Kita-Kontext wurde ich davon überrascht, dass viele Leute daran kein Interesse zu haben scheinen. Erst dachte ich, dass die alle bestimmt schon große Freund*innenkreise mit zahlreichen Kindern haben und keine neuen Bekanntschaften benötigen. Für manche trifft das sicherlich auch zu. Aber mittlerweile weiß ich, dass das bei mindestens ebenso vielen Leute nicht der Fall ist. Sie kämpfen sich so durch, und wenn es mal eng wird, werden lieber die Schwiegereltern aus Süddeutschland nach Berlin geordert, als bei den Nachbar*innen oder fellow-Kita-Eltern zu fragen. (1)
Warum ist das so? Warum igeln sich Leute in ihrer Kleinfamilie ein? Trotz aller Widrigkeiten (von denen mit der Organisation der Kinderbetreuung hier nur eine genannt sei)?
Sozialisierung und Glückserwartung der Kleinfamilie
Mir fällt vor allem ein Grund ein. Denn dort, wo die Frau* bzw. Mutter* [neben der eigenen Berufstätigkeit] in erster Linie für die Kinderbetreuung und das Häusliche zuständig ist, ist das Bitten um Hilfe in diesem Zusammenhang (oft) immer noch einem persönlichen Versagen gleichzusetzen. (2) [An besagtem Montag vor dem Mittwoch waren übrigens alle anwesenden Elternteile auf dem Spielplatz berufstätige Mütter*.]
Obwohl der Mutter* selbst vielleicht klar ist, dass das Stemmen des Mental Loads und die Verantwortung für alle (oder fast alle) Tätigkeiten rund um Kind und Haus zu viel und manchmal schlicht und ergreifend rein logistisch nicht zu bewältigen sind, hat sie immer noch den Anspruch an sich selbst, das alles irgendwie zu schaffen. Denn so ist sie sozialisiert worden. Dass dass ihre Aufgabe ist und dass sie diese als Frau* auch viel besser bewältigen kann als jeder Mann* aufgrund von Fantasie-Biologismen/Hormonen/emotionalen Fähigkeiten/bitte sonstigen Bullshit einsetzen.
Ein Beispiel dazu: Meine Oma erzählt mir seit ich denken kann davon, dass ihre Schwester angeblich besser im Haushalt war als sie, und dass ihre Eltern große Zweifel hatten, ob sie das mit Mann und Kindern hinkriegen würde. BIS HEUTE treibt sie dieser Anspruch TÄGLICH um, und ganz eindeutig hat auch meine Mutter lange gebraucht, um sich von diesem Anspruch zu befreien, was wiederum vermutlich ein Grund dafür ist, dass ich den Druck nicht so stark spüre (2).
Frauen* wird außerdem beigebracht, dass Mutter*sein und die heil(ig)e Kleinfamilie etwas unbedingt erstrebenswertes sind (hierzu sehr lesenswert: Sibel Schick über den Spruch „Du wirst mal eine gute Mutter sein.“). Der Muttermythos hat eine Strahlkraft, der man sich nicht leicht entziehen kann. Die Erfüllung mit Partner*in und Kind(ern) gilt als Gipfel der romantischen Liebe. Die Ultima Ratio des Lebensglücks. Viele Frauen* verschieben ihre „Glückserwartung fast komplett in dieses Lebensmodell (…). [D]as Zuhause ist der Sehnsuchtsort, in dem alles stimmen muss.“ (Mariam Irene Tazi-Preve, Interview hier) Richtig blöd, wenn es dann nicht so läuft, wie man sich das gedacht hat. Desillusionierend. Potentiell lebenserschütternd.
Denn die Kleinfamilie tut unter all diesen Ansprüchen vor allem eines: Versagen. DAS ist normal. Weil das Modell auf einer Aufopferung der Mutter* beruht, die übermenschliche Fähigkeiten verlangt. Da hilft es auch nicht (im Gegenteil), wenn am Muttertag die enormen Leistungen von Müttern* „gewürdigt“ und „anerkannt“ werden. Danke, aber nein danke. „Das beste Geschenk, das Mütter bekommen könnten, wären politische und betriebliche Maßnahmen, die dafür sorgten, dass Mutterschaft nicht mehr mit Überarbeitung und Geldsorgen einherginge“, schreibt Margarete Stokowski. Stimmt. Reicht aber noch nicht ganz. Ich ergänze: Das beste Geschenk, das Mütter* bekommen könnten, wären gleichberechtigte Partnerschaften, solidarische Netzwerke und eine gesellschaftliche Kultur die es ermöglicht, familiäre und häusliche Aufgaben in der Familie gerecht zu teilen und darüber hinaus ohne Ängste oder Gefühle des Versagens um Hilfe zu bitten, und mehr noch: von umsichtigen Menschen Unterstützung angeboten zu bekommen, ohne danach fragen zu müssen.
Initiative zeigen und solidarisch handeln
Ich für meinen Teil werde das nächste Mal meinem ersten Impuls folgen und eine gemeinschaftliche Kinderbetreuung anregen, auch wenn ich sie selbst nicht übernehmen kann. Ich beginne zu verstehen, dass auch das ein politischer Akt, dass auch das feministische Praxis ist: Sich in jedem Falle aus dem Privaten herauszubewegen, die vermeintliche Unzulänglichkeit der eigenen Kleinfamilie öffentlich zu machen und zur Solidarität aufzurufen.
(1) Natürlich gibt es auch die Leute, die alles gut schaffen und einfach keine Hilfe brauchen. Ebenfalls ist denkbar, dass manche Menschen es vorziehen, bestimmte Termine zu versäumen und sich deswegen nicht weiter bemühen. Weiterhin haben manche Leute auch einfach keinen Bock auf andere Leute und setzen ihre Prioritäten daher anders. Gibt’s alles. Die meine ich hier nur nicht.
(2) Nicht so, wenn abends ein*e Babysitter*in engagiert wird, damit die Eltern mal zusammen ausgehen können. Zu zweit. Als Paar. Dann, und nur dann, gilt solcher Support als angemessen.
(3) Ein anderer Grund ist, dass ich es gewohnt bin, Care-Arbeit zu teilen. TT und ich machen 50:50 (im Schnitt). Gleichberechtigung in der Partner*innenschaft ist ihm ebenso wichtig wie mir und das war auch von vornherein klar. Mit allen Konsequenzen.
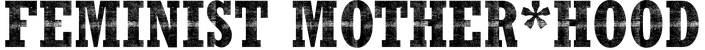
Kommentar schreiben